23.09.2025 Michael Dannhauer
ShareKI-Agenten sind digitale Assistenten, die eigenständig Aufgaben planen, Werkzeuge nutzen und komplexe Prozesse automatisieren. Sie ermöglichen eine natürliche Interaktion mit Software und unterstützen Menschen in Bereichen wie Produktion, Personalplanung oder Kundenservice. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie KI-Agenten funktionieren, welche Vorteile sie bieten, wo ihre Grenzen liegen und welche Herausforderungen bei ihrer Weiterentwicklung bestehen. Lesen Sie außerdem, wie Unternehmen wir bei INFORM KI-Agenten bereits heute einsetzen, um Abläufe effizienter zu gestalten – und wie diese Technologie unsere Zusammenarbeit mit intelligenten Systemen in Zukunft nachhaltig verändern wird.
Was ist ein KI-Agent?
KI-Agenten sind handlungsfähige, digitale Assistenten. Sie kombinieren die sprachlichen Fähigkeiten moderner Large Language Models (LLMs) mit Planungs-, Entscheidungs- und Ausführungsmechanismen. So entstehen Systeme, die eigenständig Aufgaben übernehmen, Prozesse automatisieren und den Menschen aktiv bei komplexen Entscheidungen unterstützen können. In der Praxis arbeiten Agenten meist teilautonom innerhalb klar definierter Abläufe und unter menschlicher Aufsicht. Eine vollständig autonome Arbeitsweise ist technisch möglich, wird jedoch selten angestrebt.
Früher reagierten Sprachmodelle wie ChatGPT oder Google Gemini vor allem auf einzelne Eingaben, ohne sich an vorherige Gespräche zu erinnern. Inzwischen hat sich das geändert: Moderne Modelle verfügen über erweiterte Kontext- und Gedächtnisfunktionen. Sie können Informationen aus früheren Unterhaltungen speichern, abrufen und in neue Antworten einfließen lassen. Das ermöglicht eine kontinuierlichere, personalisierte Kommunikation. Dennoch bleibt ein wichtiger Unterschied: KI-Agenten kombinieren diese sprachlichen Fähigkeiten mit zusätzlichen Mechanismen zur Planung, Ausführung und Nutzung externer Werkzeuge – und gehen damit über reine Sprachmodelle hinaus. Sie sind in der Lage, Zwischenschritte zu planen, geeignete Werkzeuge zur Lösung einer Aufgabe auszuwählen und diese in der richtigen Reihenfolge anzuwenden. Damit wird aus einem reaktiven System ein proaktiver Problemlöser – ein echter digitaler Assistent.
Hintergrund und Kontext: Woher kommt die Idee?
Erste theoretische Konzepte für KI-Agenten stammen aus den 1950er- und 60er-Jahren, als Informatiker wie John McCarthy und Marvin Minsky begannen, das Denken und Handeln von Maschinen zu modellieren. In den 1980er-Jahren entstanden die ersten Softwareagenten, die einfache Entscheidungsregeln ausführten – vor allem in der Robotik, Systemsteuerung und Simulation. Mit der Entwicklung des Internets kamen dann erste intelligentere Agenten zum Einsatz, etwa zur Filterung von Informationen oder zur Automatisierung von Nutzeraufgaben.
Der eigentliche Durchbruch kam jedoch mit der Kombination aus moderner Künstlicher Intelligenz und großen Sprachmodellen. Sie ermöglichen es, Agenten nicht nur regelbasiert, sondern lernfähig, kontextsensibel und sprachlich interaktiv zu gestalten. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Projekt „Smallville“: In einer virtuellen Stadt agierten KI-Agenten mit individuellen Zielen und Gedächtnis, kommunizierten miteinander und entwickelten komplexes Verhalten – ein Experiment, das das Potenzial solcher Systeme eindrucksvoll demonstrierte.
Wie funktioniert ein KI-Agent?
Die Grundlage eines KI-Agenten ist meist ein leistungsfähiges Sprachmodell, das durch sogenannte „Tool Use“-Fähigkeiten erweitert wird. Das bedeutet: Der Agent kann externe Werkzeuge – etwa Datenbanken, E-Mail-Systeme oder Analysefunktionen – ansteuern und kontrollieren.
KI-Agenten zeichnen sich durch mehrere Eigenschaften aus, die sie von klassischen Automatisierungen abheben Je nach Einsatzbereich vereint ein KI-Agent unterschiedlich viele Funktionen:
- Sprachliche Interaktion: Kommunikation via Sprache wird zum zentralen Steuerungsinstrument. Das gilt sowohl für eine Mensch-Maschine Interaktion als auch für die zwischen Maschinen.
- Adaptivität: Agenten lernen im Rahmen einer Session aus früheren Aufgaben, aus Interaktionen sowie aus Fakten und passen sich an neue Situationen an.
- Planungskompetenz: Sie erstellen und überarbeiten eigenständig Pläne zur Zielerreichung. Das jeweilige Ziel kann vorgegeben und dynamisch angepasst werden.
- Multitasking-Fähigkeit: Sie verarbeiten parallel Informationen aus verschiedenen Quellen.
- Werkzeugintegration: Sie agieren über APIs oder Schnittstellen direkt in operativen Systemen.
- Ein Aktionsmodell: Der Agent führt konkrete Handlungen aus, z. B. eine Aufgabe delegieren oder eine Änderung in einem Planungstool anstoßen.
Technisch gesehen entstehen KI-Agenten durch das Zusammenspiel von mehreren Komponenten:
- Prompt Engineering – zur gezielten Steuerung des Sprachmodells,
- Tool Wrapping – das Einbinden externer Funktionen,
- Execution Loop – ein Steuerkreis, in dem der Agent seinen Fortschritt kontrolliert und gegebenenfalls neu plant,
- Speicher- und Kontextverwaltung – z. B. über Vektordatenbanken oder dedizierte Speicherstrukturen.
Anwendung bei INFORM
INFORM entwickelt KI-Agenten, die direkt in bestehende Softwarelösungen integriert werden. Ziel ist es, auch komplexe Prozesse per natürlicher Sprache steuerbar zu machen, unabhängig vom Vorwissen der Anwender. Ein Beispiel ist die Personalplanung: Ein Agent kann Anfragen wie „Liste mir die Mitarbeiter, die sich heute krankgemeldet haben“ oder „Finde Ersatzkräfte für Team A“ selbstständig beantworten – inklusive Zugriff auf Datenbanken, Filterung nach Teamzugehörigkeit und Vorschlägen zur Umplanung.
Ein Blick in die nahe Zukunft zeigt: Der Agent könnte sogar von sich aus aktiv werden, einen Bericht zur Personalsituation erstellen und konkrete Handlungsempfehlungen liefern. All das, ohne dass sich die Nutzer durch Menüs oder Listen klicken müssen.
Auch in der Produktion sind solche Agenten denkbar. Etwa wenn ein Produktionsleiter fragt: „Warum ist meine Liefertermintreue gesunken?“ – und der Agent automatisch die Ursache analysiert, Ergebnisse visuell aufbereitet und Maßnahmen vorschlägt.
Der Clou dabei: Diese Fähigkeiten lassen sich nicht nur für einzelne Aufgaben einsetzen. In einem Agentennetzwerk (Swarm) können sie sogar komplexe unternehmensweite Prozesse unterstützen und koordinieren.
Spezialisten statt Generalisten: Agentenschwärme
Ein Agent muss nicht alles können. Viel effektiver ist es, spezialisierte Agenten zu erstellen, die auf einen klar begrenzten Aufgabenbereich fokussiert sind – z. B. Datenanalyse, Report-Erstellung oder Kundenkommunikation.
Diese Agenten können dann miteinander kommunizieren, Aufgaben delegieren und sich gegenseitig Ergebnisse übergeben. So entsteht ein Agentenschwarm, der skalierbar, anpassbar und fehlertolerant ist.
Vor- und Nachteile von KI-Agenten
Vorteile
- Automatisierung komplexer Aufgaben: KI-Agenten können mehrstufige Prozesse eigenständig planen und ausführen.
- Natürliche Interaktion: Die Steuerung per Spracheingabe erleichtert den Zugang, auch für nicht-technische Nutzer.
- Lernfähigkeit: Agenten verbessern sich durch kontinuierliche Nutzung und passen sich an neue Anforderungen an.
- Entlastung der Mitarbeitenden: Standardaufgaben können delegiert werden, sodass mehr Zeit für strategische Tätigkeiten bleibt.
- Flexibilität: Agenten lassen sich auf spezifische Aufgabenbereiche trainieren und in bestehende Systeme integrieren.
- Skalierbarkeit: In Form von Agentenschwärmen können sie auch große, komplexe Prozesse koordinieren.
Nachteile
- Erklärbarkeit: Entscheidungen von Agenten sind nicht immer transparent oder nachvollziehbar.
- Abhängigkeit von Datenzugriff: Ohne strukturierte und aktuelle Datenquellen sind viele Funktionen eingeschränkt.
- Kosten für Entwicklung und Integration: Der Aufbau zuverlässiger Agentensysteme erfordert technisches Know-how und Investitionen.
- Sicherheitsrisiken: Unsachgemäßer Zugriff auf Systeme oder fehlerhafte Automatisierung kann zu Problemen führen.
- Begrenzte Generalisierung: Ein Agent funktioniert oft nur gut in seinem eng definierten Aufgabenbereich.
- Rechtliche und ethische Fragen: Datenschutz und Haftung müssen klar geregelt werden. Darüber hinaus muss gesichert sein, dass ein KI Agent neutrale, gerechte und diskriminierungsfreie Ergebnisse liefert.
FAQ zu KI-Agenten
Brauche ich Programmierkenntnisse, um einen KI-Agenten zu nutzen?
Nein. Moderne KI-Agenten sind so konzipiert, dass sie über natürliche Sprache bedient werden können. Technische Kenntnisse sind für die Nutzung nicht erforderlich – allerdings ist für die Entwicklung oder Anpassung eines Agenten meist IT-Fachwissen nötig.
Wie lange dauert es, bis ein KI-Agent einsatzbereit ist?
Das hängt vom Anwendungsfall ab. Für einfache Aufgaben mit bestehenden Schnittstellen kann ein Agent in wenigen Tagen konfiguriert werden. Komplexe, unternehmensspezifische Szenarien mit vielen Datenquellen und individuellen Anforderungen benötigen jedoch mehrere Wochen bis Monate – inklusive Tests und Anpassung.
Gibt es bereits fertige KI-Agenten, oder muss jeder individuell entwickelt werden?
Beides ist möglich. Es gibt Standardlösungen, z. B. für Textanalyse oder Terminverwaltung, aber auch maßgeschneiderte Agenten, die speziell auf die Prozesse eines Unternehmens angepasst sind – wie sie etwa bei INFORM entwickelt werden.
Welche Branchen profitieren besonders von KI-Agenten – und warum?
Branchen wie Logistik, Produktion, Finanzdienstleistungen, Personalplanung oder Kundenservice profitieren besonders, weil dort täglich große Datenmengen verarbeitet, viele Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen und komplexe Abläufe koordiniert werden müssen. KI-Agenten unterstützen dabei, relevante Informationen schneller zu finden, Entscheidungen vorzubereiten und Routineaufgaben zu automatisieren – ohne dass Mitarbeitende Systeme manuell durchforsten oder ständig zwischen Anwendungen wechseln müssen.
Fazit
KI-Agenten heben die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine auf ein neues Niveau!
In den kommenden Jahren werden sie viele Arbeitsprozesse grundlegend verändern. Deshalb entwickelt INFORM diese Technologien aktiv weiter – mit dem Ziel, Softwarelösungen intuitiver, intelligenter und effizienter zu gestalten.
ÜBER UNSERE EXPERT:INNEN
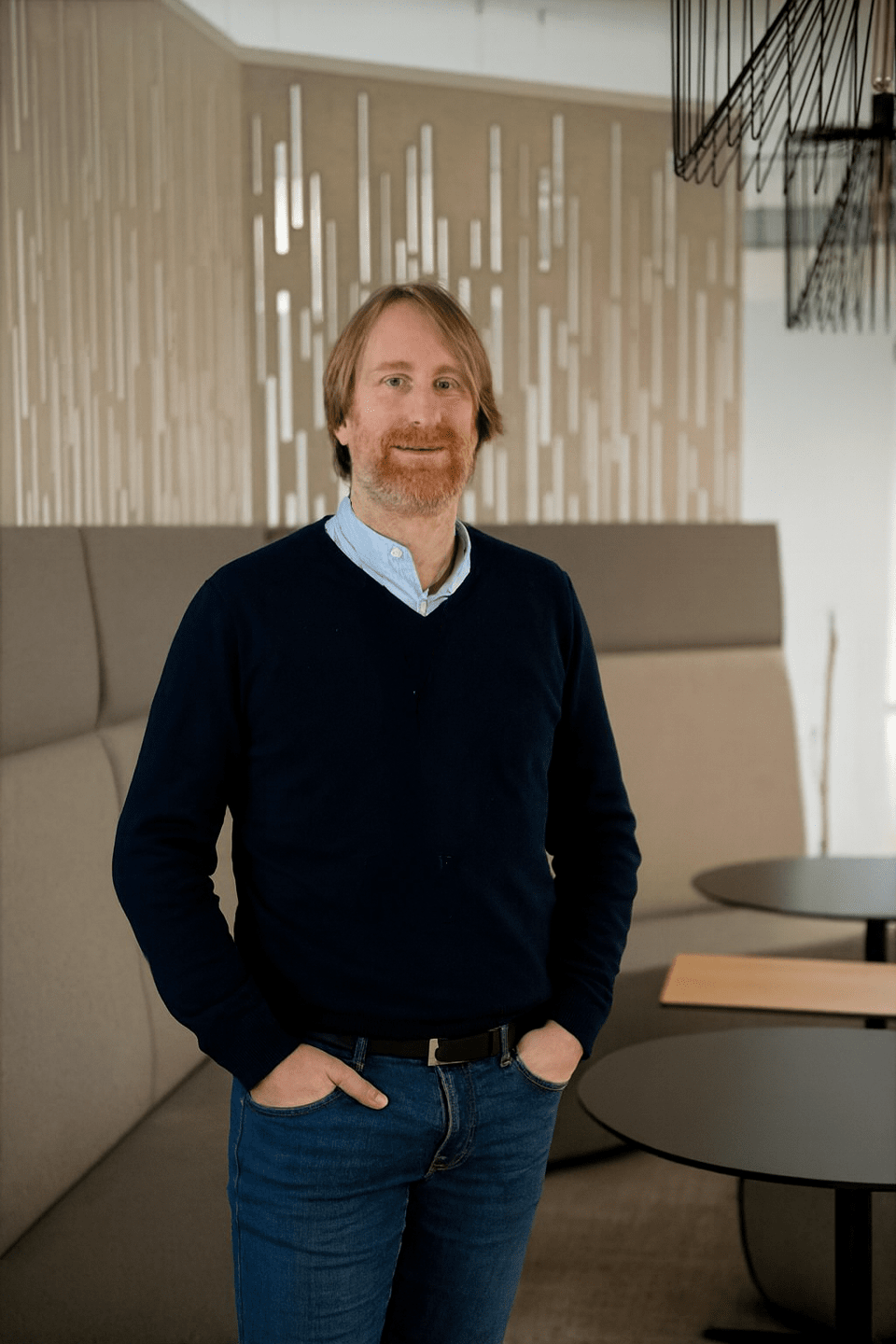
Michael Dannhauer
Michael Dannhauer ist seit 2002 im Corporate Marketing bei INFORM tätig und beschäftigt sich mit Themen rund um die Optimierung von Geschäftsprozessen mithilfe von KI.

