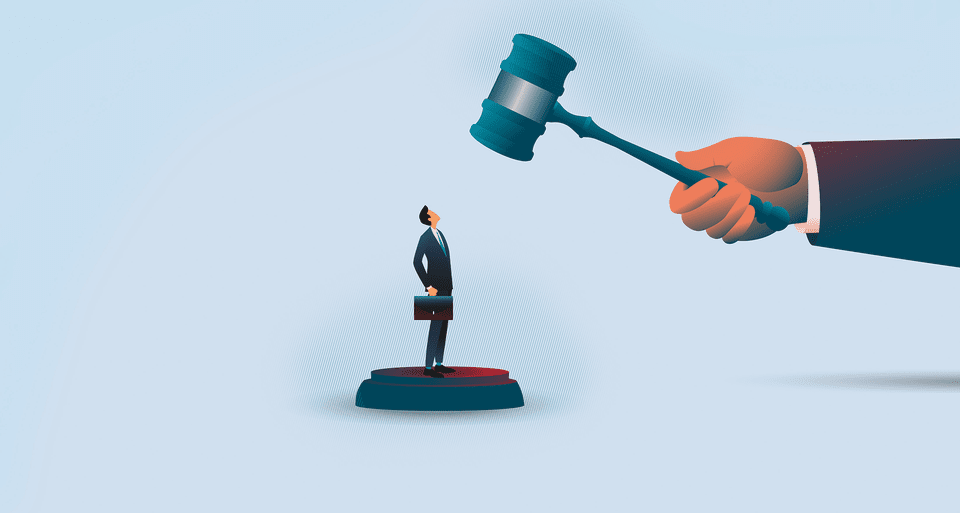18.11.2025 Dr. Stephan Lemkens
ShareGeschwindigkeit wird zur neuen regulatorischen Währung
Die Zeiten, in denen Aufsichtsbehörden lediglich das Vorhandensein eines AML-Systems einforderten, sind endgültig vorbei. Heute zählt nicht mehr, ob Banken verdächtige Aktivitäten erkennen können, denn das setzen die Regulatoren voraus. Entscheidend ist stattdessen, wie schnell und konsistent die nachgelagerten Prozesse funktionieren. Genau dort, im Maschinenraum der operativen Compliance, entstehen inzwischen die eigentlichen Risiken. Und genau dorthin richtet die Aufsicht ihren Blick.
Was früher ausreichte, etwa ein gutes Transaktionsmonitoring oder ein klar definierter Untersuchungsprozess, genügt nicht mehr. Die aktuelle Aufsichtspraxis zeigt, dass Institute zwar oft solide Detektionsmechanismen besitzen, im entscheidenden Moment jedoch ins Straucheln geraten, sobald ein Alarm tatsächlich untersucht und gemeldet werden muss.
Die Fehlentwicklungen entstehen nicht im Moment der Erkennung, sondern in dem, was danach folgt, und die jüngste Rekordstrafe in Deutschland in Höhe von rund 45 Millionen Euro zeigt exemplarisch, wohin die Aufsicht ihren Fokus verschiebt: Versäumnisse entstehen mittlerweile seltener am Anfang eines AML-Prozesses, sondern am Ende, also dort, wo interne Workflows zu langsam sind, Daten nicht sauber zusammengeführt werden oder Meldefristen aufgrund manueller Tätigkeiten reißen. Das ist nicht nur ein Einzelfallproblem, sondern Ausdruck eines strukturellen Trends im Markt.
Der Maschinenraum der Compliance: Wo es heute wirklich klemmt
Dass die Geschwindigkeit zur neuen Währung der Geldwäscheprävention geworden ist, hat mehrere Gründe. Zum einen wächst das Transaktionsvolumen in nahezu allen Instituten weiter. Damit steigt auch die Anzahl der Alarme, die täglich analysiert werden müssen. Zum anderen haben die Behörden längst erkannt, dass Geldwäsche nicht auf die nächste Woche wartet. Verdachtsmeldungen, die zu spät abgegeben werden, verlieren an operativem Wert, da Ermittlungen nur dann erfolgversprechend sind, wenn sie zeitnah erfolgen.
Die gesetzlichen Erwartungen sind eindeutig: Meldungen müssen unverzüglich erfolgen. In der heutigen regulatorischen Auslegung bedeutet dies oft eher Stunden als Tage. Diese Beschleunigung trifft jedoch auf Prozesse, die vielerorts noch durch Medienbrüche, Doppelarbeiten und unzureichende Transparenz geprägt sind.
Europa schaltet hoch: Die AMLA setzt neue Maßstäbe
Parallel dazu verschiebt sich das gesamte europäische AML-Regime. Mit der neuen AMLA, der europäischen Anti-Money-Laundering Authority, wird sich die Branche auf ein Aufsichtsniveau einstellen müssen, das deutlich über dem liegt, was viele Länder bislang gewohnt sind. Orientierungspunkt werden Staaten sein, die gezeigt haben, dass AML-Prozesse nicht nur gründlich, sondern auch extrem schnell funktionieren können.
Die Niederlande schaffen es beispielsweise, interne Untersuchungen und Meldungen in Zeitfenstern abzuwickeln, die in anderen europäischen Ländern kaum vorstellbar sind. Wenn die AMLA ihre Arbeit vollständig aufgenommen hat, wird sich der Maßstab deutlich verschieben. Der Fokus wird sich weg vom Mindeststandard hin zu Best-Practice-Niveaus bewegen. Institute, die heute noch mit einer fragmentierten Prozesslandschaft arbeiten, geraten dadurch zusätzlich unter Druck.
Warum End-to-End-Prozesse zur Grundvoraussetzung werden
Für Banken bedeutet dieser regulatorische Wandel eines: Wer sich weiterhin auf isolierte Systeme und manuelle Workflows verlässt, setzt sich künftig erheblichem Risiko aus. Daten liegen häufig verteilt in unterschiedlichen Systemen. Analysten müssen Informationen mühsam zusammensuchen. Eskalationen laufen per E-Mail, Fristen werden in Excel-Listen nachgehalten, und parallel steigen die Erwartungen an Geschwindigkeit und Präzision.
Umso wichtiger werden sowohl ganzheitliche, integrierte Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche anstelle von isolierten Maßnahmen wie auch integrierte End-to-End-Prozesse, die vom ersten Alarm bis zur finalen Verdachtsmeldung durchgängig unterstützt werden. Moderne Systeme helfen dabei, alle relevanten Daten automatisch in den Fall zu ziehen, den Bearbeitungsprozess klar zu strukturieren und Fristen zuverlässig zu überwachen.
Ein zentrales Element ist das Reporting selbst. Ein technisches Modul, das Analysten Schritt für Schritt durch die Erstellung der Meldung führt, bereits vorhandene Fallinformationen automatisch übernimmt und am Ende die offizielle Meldedatei erzeugt, zum Beispiel im goAML- oder FinCEN-Format, reduziert den Zeitaufwand erheblich. Es schafft Transparenz und sorgt dafür, dass der gesamte Prozess nachvollziehbar dokumentiert ist. Die fachliche Bewertung ersetzt es nicht, aber es stellt sicher, dass der Weg dorthin vollständig und regulatorisch belastbar bleibt.
AML muss nicht nur besser werden, sondern vor allem schneller
Die Konsequenz aus all dem ist klar: AML muss schneller werden, und zwar nicht oberflächlich, sondern strukturell. Die Branche steht vor einem Übergang von manuell geprägten Abläufen hin zu digital unterstützten Prozessketten.
Institute, die diesen Schritt frühzeitig gehen, reduzieren nicht nur das Risiko regulatorischer Sanktionen. Sie schaffen darüber hinaus Rahmenbedingungen, die es ihren Compliance-Teams ermöglichen, ihre Aufgaben fundiert, effizient und nachhaltig zu erfüllen. Dies ist heute wichtig und wird es in einem Umfeld, das immer stärker auf Qualität und Tempo achtet, noch viel mehr sein.
Wenn Sie erfahren möchten, was das für Ihr Unternehmen bedeutet und wie unsere AML-Compliance-Lösung RiskShield Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen kann, wenden Sie sich an unsere Experten.
ÜBER UNSERE EXPERT:INNEN

Dr. Stephan Lemkens
Solution Owner Compliance | Risk & Fraud
Stephan ist seit 2018 als Berater im Professional Services Teams tätig und hat Erfahrungen mit Projekten gesammelt, die sich auf die Transaktions- und Sitzungsüberwachung im Zusammenhang mit Betrugsprävention konzentrieren. Seit 2020 konzentriert er sich auf Compliance und arbeitet eng mit unseren Kunden an Projekten rund um die Überwachung verdächtiger Aktivitäten und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zusammen.