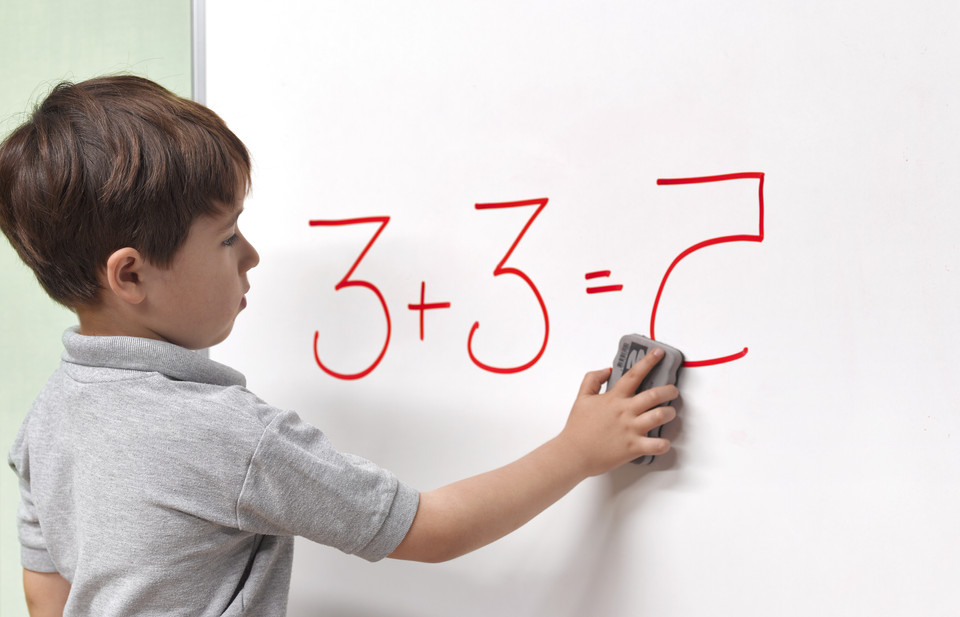29.10.2025 Hannah Kuck
ShareMit dem Aufkommen von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) zum Dauerthema geworden. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Medien über neue Anwendungen, Chancen oder Risiken berichten. In vielen Unternehmen wird eifrig diskutiert, wie sich KI am besten nutzen lässt. Der Hype konzentriert sich in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals vor allem auf Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLMs).
Damit gerät leicht in Vergessenheit, dass KI viel mehr kann als Texte zu schreiben oder Bilder zu generieren. Eine weitere Stärke liegt in der Unterstützung komplexer Entscheidungen und in der Optimierung von Prozessen. Unter anderem in Branchen wie in der industriellen Produktion oder in der Logistik, aber auch dem Finanzwesen oder der Telekommunikation zeigt sich: Hier entscheidet der richtige Einsatz von KI über Effizienz, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Um diese Perspektive klarer zu machen, räumen wir mit vier gängigen Irrtümern über KI auf. Und werfen einen Blick darauf, wo sie in der Praxis tatsächlich den größten Nutzen stiftet.
Irrtum 1: „KI ist gleich ChatGPT“
Large Language Models sind derzeit die prominentesten Vertreter der KI. Sie können Texte formulieren, Code schreiben oder Bilder erzeugen. Das beeindruckt und begeistert viele und das aus gutem Grund: In manchen Fällen lassen sich mit Sprachmodellen Aufgaben erledigen, die früher Tage oder gar Wochen in Anspruch genommen hätten. Solche Effizienzgewinne verdeutlichen, welches Potenzial in dieser Technologie steckt.
Gleichzeitig gilt: So leistungsfähig Sprachmodelle auch sind, sie bilden dennoch nur einen Teil der gesamten KI-Welt ab. Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeugkasten mit ganz unterschiedlichen Methoden: von Machine Learning über mathematische Optimierung und Simulation bis hin zu regelbasierten Systemen und KI-Modellen, die operative Entscheidungen in Unternehmen treffen. Welche Methode sinnvoll ist, hängt stark vom Anwendungsfall ab.
In der Luftfahrt kommt KI zum Beispiel mit Optimierungsverfahren zum Einsatz, die exakt berechnen, wie Personal, Fahrzeuge und Ressourcen aufeinander abgestimmt werden müssen. Diese Systeme werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt und nun um neue Technologien erweitert. Künstliche Intelligenz ist also nicht erst mit ChatGPT in die Welt gekommen.
Ähnlich ist es in der Produktion: KI-Systeme helfen etwa im Maschinenbau, die Reihenfolgen von tausenden Arbeitsschritten auf vielen Maschinen so zu planen, dass Liefertermine eingehalten und Kosten minimiert werden. Solche Aufgaben sind typisch für Entscheidungsintelligenz (Decision Intelligence) und zeigen, dass KI weit mehr ist als Sprachverarbeitung. Sie ist also nur ein Aspekt von Künstlicher Intelligenz, aber einer, der Türen zu vielen weiteren Anwendungen öffnet.
Irrtum 2: „KI ersetzt alle menschlichen Entscheidungen.“
Die Idee, KI könne früher oder später alle menschlichen Entscheidungen übernehmen, ist faszinierend, aber sie übersieht die Komplexität und Verantwortung menschlichen Handelns. Zwar existieren Visionen von vollautonomen Systemen, doch in der Praxis wird KI vornehmlich als Assistenzsystem eingesetzt.
KI kann Daten aus unterschiedlichsten Quellen integrieren, Muster erkennen, Szenarien simulieren und daraus fundierte Vorschläge ableiten. In vielen Fällen trifft sie Entscheidungen autonom, allerdings meist nur bei standardisierten, repetitiven Aufgaben mit klaren Regeln. Für komplexe, strategische oder einzigartige Situationen bleibt menschliches Eingreifen essenziell.
Ein praxisnahes Beispiel aus dem Workforce Management verdeutlicht dies: Angenommen, ein Unternehmen muss für eine Woche Schichtpläne erstellen und dabei sind zu berücksichtigen: maximale Arbeitszeitgrenzen, Ruhezeiten, individuelle Verfügbarkeiten, gesetzliche Vorgaben, Produktionsanforderungen und vieles mehr. Die KI berechnet innerhalb kurzer Zeit mehrere Varianten, die diese Bedingungen bestmöglich erfüllen und gleichzeitig Auslastung und Fairness optimieren.
In der Praxis übernimmt der Mensch die endgültige Entscheidung beispielsweise dann, wenn zwischen KI-Vorschlägen kaum ein Unterschied besteht, aber soziale Aspekte stärker ins Gewicht fallen – etwa, wenn Mitarbeitende über mehrere Tage hintereinander ungünstige Schichten bekommen – oder wenn plötzliche Änderungen eintreten (z. B. krankheitsbedingte Ausfälle, Eilaufträge). In solchen Fällen wählt das Management unter Abwägung von Effizienz, Mitarbeiterzufriedenheit und strategischen Zielen den Plan aus der KI-Vorschlagsliste.
Mit zunehmender Reife werden KI-Systeme künftig über noch mehr Entscheidungen autonom entscheiden können. Doch es wird immer Situationen geben, in denen Ausnahmen, Qualitätskontrollen, Sonderfälle oder strategische Differenzierungen eine menschliche Bewertung erfordern. So ersetzt KI nicht zwangsläufig alle menschlichen Entscheidungen, sondern erweitert und unterstützt sie, unter bewusster Gestaltung und Kontrolle.
Irrtum 3: „KI ist eine Black Box und nicht nachvollziehbar.“
Viele Unternehmen schrecken davor zurück, KI einzusetzen, weil sie glauben, Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar. Dieses Bild stimmt nur teilweise. Generative Modelle und tiefe neuronale Netze sind tatsächlich komplex und schwer erklärbar. Doch es gibt zahlreiche KI-Ansätze, die hochgradig transparent arbeiten.
Optimierungsalgorithmen lassen sich Schritt für Schritt nachvollziehen. Jede Entscheidung, die ein solches System trifft, basiert auf klaren Regeln und mathematischen Berechnungen. Gerade in stark regulierten Branchen ist diese Nachvollziehbarkeit entscheidend.
So setzen Banken und Zahlungsdienstleister heute erklärbare Hybrid-KI-Modelle ein, um Transaktionen auf Betrugsrisiken zu prüfen. Dabei werden erklärbare Regeln mit lernenden Komponenten kombiniert: Wenn eine Zahlung als potenziell verdächtig markiert wird, kann nachvollzogen werden, welche Merkmale den Alarm ausgelöst haben – etwa geografische Abweichungen, eine plötzliche Auslandsüberweisung, eine ungewöhnliche Menge an Einzeltransaktionen oder eine Abweichung vom bisherigen Nutzungsverhalten.
Die Entscheidung, diese Transaktion zu blockieren oder zur manuellen Prüfung weiterzuleiten, bleibt letztlich beim Menschen. Gleichzeitig ist für Compliance und Aufsichtsbehörden erkennbar, wie die Bewertung zustande kam.
In der Telekommunikation kommt eine ähnliche Herangehensweise zum Einsatz, wenn es um das Management finanzieller Risiken mit Kunden geht. Wenn ein Anbieter Ratenzahlungen oder Finanzierungskomponenten für Geräte ermöglicht, nutzt er erklärbare KI-Modelle, um Ausfallrisiken zu bewerten. KI ist also nicht zwangsläufig eine Black Box. Vielmehr kommt es darauf an, die richtige Technologie für den jeweiligen Anwendungsfall zu wählen.
Irrtum 4: „KI ist nur für digitale Vorreiter interessant.“
Manchmal entsteht der Eindruck, dass KI-Lösungen vor allem in technologieorientierten Unternehmen sinnvoll seien, etwa in Softwarefirmen, Start-ups oder rein digitalen Geschäftsmodellen – insbesondere, weil solche Firmen häufig über große Datenmengen, digitale Infrastruktur und Innovationskultur verfügen. Doch dieser Eindruck greift zu kurz. KI-Technologien schaffen bereits heute hochwertige Mehrwerte nicht nur in Tech-Nischen, sondern quer über verschiedenste Branchen und Prozesse hinweg.
In der Fahrzeuglogistik etwa optimieren KI-Systeme die Reihenfolge, in der Fahrzeuge auf Züge oder Schiffe verladen werden. Klingt banal, hat aber enorme Auswirkungen: Werden Autos ungünstig platziert, blockieren sie bei der Entladung andere Fahrzeuge. Das führt zu längeren Wartezeiten, unnötigen Rangierbewegungen und zusätzlichen Transportkosten.
KI berechnet die optimale Reihenfolge so, dass Fahrzeuge am Zielort direkt verfügbar sind. Das spart Zeit, reduziert Kosten und verbessert gleichzeitig die CO₂-Bilanz, weil weniger Umwege und Leerlauf entstehen. In der maritimen Industrie wird mithilfe von KI geplant, wie Container effizient auf Schiffe und Terminals verteilt werden. Dadurch lassen sich Umschlagszeiten verkürzen und Engpässe vermeiden. Und im Handel helfen KI-gestützte Absatzprognosen dabei, Überbestände zu vermeiden und Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.
Diese Beispiele zeigen: KI ist kein Zukunftsthema für „digitale Vorreiter“ aus dem Silicon Valley. Sie ist heute schon ein Schlüssel in einem breiten Spektrum von Branchen, in denen unter anderem Effizienz und Resilienz entscheidend sind.
Vom Hype zur Praxis: Worauf es wirklich ankommt
KI ist kein monolithisches System, sondern ein flexibler Werkzeugkasten. Wer sie nur mit Sprachmodellen gleichsetzt, übersieht entscheidende Chancen. Wirklich erfolgreich wird der Einsatz dann, wenn Unternehmen differenzieren: Welches Problem habe ich, welche Technologie löst es am besten, und wie integriere ich sie in meine Prozesse?
INFORM unterstützt Unternehmen verschiedener Branchen dabei, genau diese Fragen zu beantworten. Unsere Lösungen bringen Entscheidungsintelligenz in komplexe Geschäftsprozesse, steigern Effizienz und schaffen Zukunftssicherheit. So wird aus dem viel diskutierten Hype eine greifbare Praxis. Und aus Technologie echter Mehrwert.
ÜBER UNSERE EXPERT:INNEN

Hannah Kuck
Corporate Communications Managerin
Hannah Kuck ist seit August 2024 als Corporate Communications Managerin im Corporate Marketing bei INFORM tätig. Mit einer Leidenschaft für kreative und wirkungsvolle Kommunikation gestaltet sie verschiedene Bereiche der Unternehmenskommunikation mit – von Pressearbeit über Content Creation bis hin zu Storytelling.